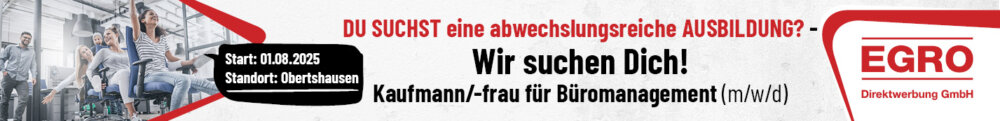Bildungsdezernentin Weber: „Wir wollen herausfinden, wie Zugang zu Bildung in den jeweiligen Stadtteilen verbessert werden kann“
Die Stadtteile Kalbach-Riedberg, Höchst, Ginnheim und Ostend wurden als Pilotstadtteile für das Programm Bildungskommune Frankfurt ausgewählt. Dort werden nun Stadtteillabore eingerichtet, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern der Frage nachzugehen, wie Bildung für alle zugänglich gemacht werden kann.
„Ziel des Programms Bildungskommune ist es, Bildungsangebote und -akteure zu vernetzen und sichtbarer zu machen, um so einen besseren und niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen – für alle Frankfurterinnen und Frankfurter, von Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren. Die Erkenntnisse, die wir nun in den Pilotstadtteilen gewinnen, sollen die gesamte Frankfurter Bildungslandschaft bereichern“, erläutert Bildungsdezernentin Sylvia Weber.
Pilotstadtteile spiegeln unterschiedliche Stadtrealitäten wider
Die vier Pilotstadtteile können anhand von Bildungs- und Bevölkerungsdaten drei Typen von Stadtteilen zugeordnet werden. Die Typen 1 (Kalbach-Riedberg) und 2 (Höchst) umfassen Stadtteile, die hinsichtlich der Bildungsbeteiligung und der sozialen Benachteiligung jeweils gegensätzliche demographische Strukturen aufweisen. Ein dritter Typ (Ginnheim und Ostend) umfasst die Stadtteile, die in diesen Aspekten dem stadtweiten Durchschnitt entsprechen, weil Pilotstadtteile insgesamt möglichst viele Realitäten der Stadt abbilden sollen. Bei der Auswahl von Typ 3 lag der Fokus daher auf einer heterogenen Bevölkerungsstruktur innerhalb des Stadtteils.
Die in Frage kommenden Stadtteile wurden nach weiteren Aspekten ausdifferenziert wie etwa städtebauliche Entwicklungen, vorhandene Bildungsangebote oder Altersstruktur. Der fachliche Programmbeirat der Bildungskommune Frankfurt hat zur Vorschlagsliste beraten, insgesamt wurden vier Pilotstadtteile ausgewählt.
Lösungen entwickeln für Bildungsteilhabe vor Ort: Umsetzung von Stadtteillaboren
Um die Bedürfnisse der Menschen vor Ort besser zu verstehen, werden in den vier Pilotstadtteilen von Mai 2025 bis Sommer 2026 sogenannte Stadtteillabore umgesetzt. Sie dienen als offene Räume, in denen sich Bürgerinnen und Bürger in Dialog-Formaten zu Bildung austauschen, Ideen sammeln, weiterentwickeln und ausprobieren können. Dabei werden unterschiedliche Formate getestet: Workshops, Veranstaltungen sowie auch mobile und digitale Formate. „Ziel ist es, die Menschen, Orte und Einrichtungen in den Pilotstadtteilen aufzusuchen und gemeinsam herauszufinden, wie der Zugang zu Bildung in den jeweiligen Stadtteilen verbessert werden kann“, sagt Weber.
Für den Auftakt in diese Beteiligungsphase wird das Programmteam zunächst flexibel unterwegs sein und auch Material zum Mitmachen dabeihaben. Egal ob auf dem Spielplatz, Wochenmarkt, bei Stadtfesten oder anderen Anlässen: Es wird vielfältige Möglichkeiten für alle Altersgruppen geben, sich zu beteiligen und ins Gespräch zu kommen.
Im Ergebnis zielen die Stadtteillabore darauf, die Wahrnehmung der Menschen vor Ort mit den vorhandenen kommunalen Daten abzugleichen, relevante Fragestellungen aufzugreifen und in ein Datenbasiertes Kommunales Bildungsmanagement (DKBM) einfließen zu lassen.
Über das Programm Bildungskommune Frankfurt
Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe. Doch nicht alle Menschen in Frankfurt haben den gleichen Zugang zu Bildungsangeboten. Mit der Teilnahme am „ESF Plus-Förderprogramm Bildungskommunen“ des Europäischen Sozialfonds für Deutschland von Dezember 2023 bis Dezember 2027 arbeitet die Stadt Frankfurt daran, mehr Zugänglichkeit zu Bildung zu schaffen. Mit dem Fokus auf Inklusion und Integration durch Bildung richtet sich das Programm an alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Alter, Herkunft oder Lebenssituation. Ziel ist es, Benachteiligungen datenbasiert sichtbar zu machen, die Bildungsangebote klarer zu strukturieren und eine stärkere digitale sowie analoge Vernetzung der Bildungsakteure zu schaffen.
(Text: PM Stadt Frankfurt)